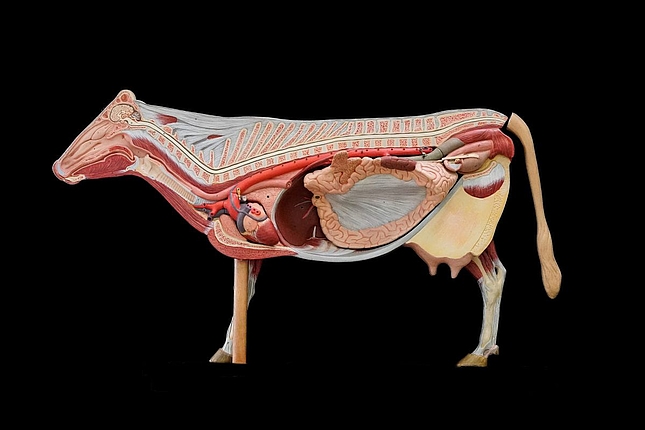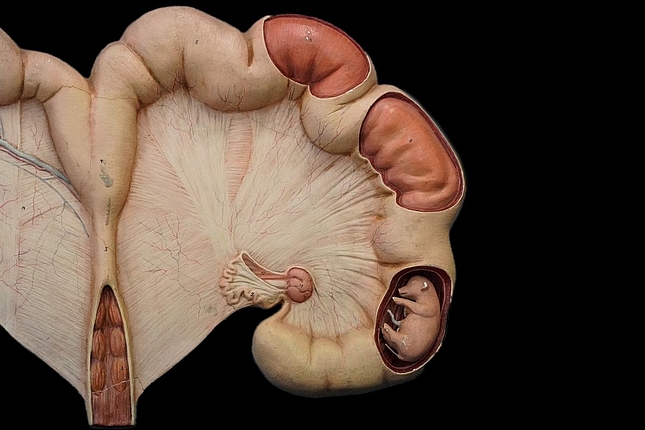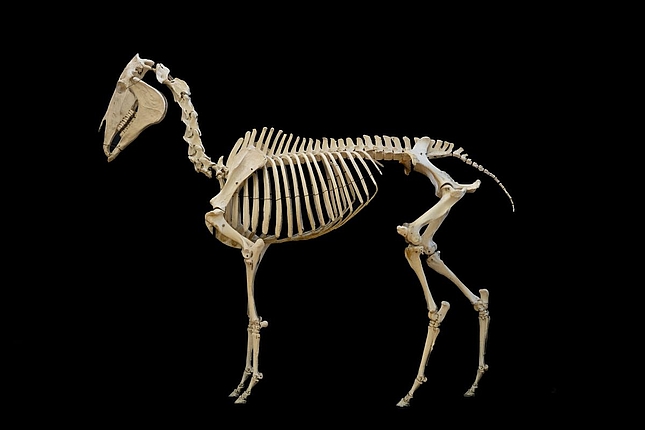Agrarwirtschaft (B.Sc.)

Die Agrarwirtschaft steht im Zentrum der globalen Herausforderungen unserer Zeit und ist gleichzeitig prägend für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in unserem unmittelbaren regionalen Umfeld.
Langfristige Sicherung der Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln und Biorohstoffen, Klimawandel, Tier- und Umweltschutz, Entwicklung ländlicher Räume, nachhaltige Betriebs- und Unternehmensentwicklung sind die übergeordneten Themen, für deren praktische Bearbeitung die Studierenden der Agrarwirtschaft qualifiziert werden.
Im Verlauf des Studiums wird hierzu ein breites Spektrum aktueller und zukunftsorientierter Fragestellungen behandelt:
- Produktionstechnik im Pflanzenbau und der Tierhaltung
- Betriebs- und Marktlehre, Marketing sowie Agrarpolitik
- Beitrag der Landwirtschaft zur Lösung von Energie- und Umweltproblemen
- Ökologischer Landbau
- Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung
- Erhaltung unserer Kulturlandschaft
- Anpassung an den Klimawandel
- Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft
Das Studium ist gekennzeichnet durch:
- Ein Studienkonzept mit hohen Praxisanteilen
- Professor*innen und Lehrbeauftragte mit praktischer Berufserfahrung
- Übungen und Projektarbeiten in kleinen Gruppen
- Direkten Kontakt zum Lehrpersonal
- Lehr- und Versuchsbetriebe in unmittelbarer Nähe
- Kooperationen mit der Praxis, Landesanstalten und Verbänden
Online Infotag
Sie möchten mehr über den Studiengang erfahren?
Dann nehmen Sie doch teil an unserer Online Informationsveranstaltungen am Samstag, 24. Mai 2025 um 10:00!
Bitte melden Sie sich bis zum 23. Mai 12:00 Uhr per Mail an. info-aw@no spamhfwu.de
Eckdaten
Abschluss:
Bachelor of Science (B.Sc.)
Regelstudienzeit:
7 Semester, davon 1 Praxissemester im 4. Semester
Start: Wintersemester
Bewerbungsfrist: 15. Juli
Standort:
Nürtingen
Unterrichtssprache:
Deutsch

Studienverlauf
Semester 1-3: Grundlagenstudium
Naturwissenschaftliche Grundlagen (Mathe, Physik, Chemie, Ökologie, Botanik, Genetik)
Grundlagen Pflanzenproduktion & Tierische Erzeugung
1-jähriges Praxisprojekt in kleinen Gruppen
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Einführung Agrartechnik
Semester 4: Praxissemester
Semester 5-7: Vertiefungsstudium
Betriebswirtschaft, Ökologie, Agrar- und Umweltrecht, Agrartechnik, Projektarbeit
Auswahl einer Vertiefungsrichtung aus den Bereichen:
- Agrarumweltmanagement
- Pflanzenproduktion
- Tierische Erzeugung
2 Wahlmodule, Auswahl aus den Fachgebieten:
Ökonomie, Tierhaltung, Pflanzenproduktion, Pferdewirtschaft, interdisziplinär
Studieninhalte
Modulübersicht
AW 1. Semester
Grundlagen Tierwissenschaften (201-003)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Allgemeine Ethologie und Tierschutz
Umfang: 1,5 SWS (1,875 ECTS)
Format : Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Grundlagen der Ethologie und des Tierschutzes:
- Biologische Grundlagen: Evolutionsbiologie, Systematik (Pisces (Fische), Amphibia (Amphibien), Reptilia (Kriechtiere), Aves (Vögel), Mammalia (Säugetiere))
- Allgemeine Ethologie: Geschichte der Verhaltenswissenschaft, Verhaltensantriebe, Verhaltenssteuerung, Erwerb von Verhalten, Methoden der Verhaltensforschung, Sinneswahrnehmung der Tiere, Soziale Organisation der Nutztiere, Lernen der Tiere
- Tierschutz: Tierschutzethik, Tierschutzrecht, Beurteilung von Tierhaltungen (Du-Evidenz, Analogieschlüsse, Befindlichkeitskonzept, Consumer-Demand Ansatz, Handlungsbereitschaftsmodell, Bedarfsdeckungs- und Schadenvermeidungskonzept, TGIs)
Lehrveranstaltung 2: Anatomie und Physiologie
Umfang: 2,5 SWS (3,125 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Grundlagen der Anatomie und Physiologie der landwirtschaftlichen Nutztiere (Wiederkäuer, Schwein, Pferd, Geflügel):
- Aufbau und Funktion der Organsysteme
- Folgen von Veränderungen physiologischer Verhältnisse
- Unterschiede im Organaufbau bei den verschiedenen Tierarten
- Voraussetzungen für eine tiergerechte und gesunde Nutztierhaltung, Fütterung und Zucht
Einführung in die Ökonomie (201-004)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Allgemeine landwirtschaftliche Betriebslehre
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Begriffe und Einordnung der landwirtschaftlichen Betriebslehre
- Wirtschaftseinheiten der Land- und Pferdewirtschaft
- Besonderheiten der landwirtschaftlichen Produktion
- Neoklassische Theorie der landwirtschaftlichen Produktion
- Grundlagen der Leistungs-Kosten-Rechnung
Lehrveranstaltung 2: Volkswirtschaftslehre
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
- Marktgleichgewicht in der Marktwirtschaft
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Einkommensverteilung in der Volkswirtschaft
- Grundlagen der Wirtschaftspolitik
- Stabilität und Wachstum in der Marktwirtschaft
- Grundlagen der Umweltpolitik
Finanzbuchführung und Statistik (201-005)
Verantwortlich: Prof. Dr. Konstanze Krüger-Farrouj
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Finanzbuchführung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)
Inhalte
- Die Studierenden erwerben ein breites Spektrum an Theorie und Faktenwissen im Rechnungswesen landwirtschaftlicher Betriebe:
- Gliederung und Aufgaben des landwirtschaftlichen Rechnungswesens
- Inventurverfahren und Inventursysteme
- Grundlagen des Systems der doppelten Buchführung
- Rechtsgrundlagen
- Von der Inventur zur Bilanz
- Buchen auf Konten, insbes. auf Bestands-, Erfolgs-, Privat- und Umsatzsteuerkonten, Abschluss der Konten
- Technik der doppelten Buchführung, laufende Buchungen, vorbereitende Abschlussbuchungen, Abschlussbuchungen
- Pauschalierung, Regelbesteuerung
- Abschreibungsmethoden
- Führen von Grund- und Hauptbuch
- Buchführungsverfahren
- Besondere Fragen des Jahresabschlusses, u.a. Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierung und Bewertung, Arten von Jahresabschlüssen, Kennzahlenermittlung, Analyse des Jahresabschlusses
Lehrveranstaltung 2: Statistik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)
Inhalte
Die Studierenden erwerben Wissen über statistische Begriffe, Fakten, Grundsätze und Methoden
- Hypothesenbildung
- Beschreibende Statistik
- Aufstellung und Verwaltung von Tabellen
- Schließende Statistik
- Berechnung und Darstellung von Prozentplätzen und –rängen, Mittelwerten und Streuungsmaßen, Häufigkeitsverteilungen
- Korrelationsrechnung und Nutzung von Kontingenztafeln
- parametrische und parameterfreie Testverfahren
Mathematik und Physik (201-006)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Mathematik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Mengenlehre
- Mengen
- Mengenoperationen
Lineare Gleichungssysteme
- Lösungsverfahren für einfache Gleichungssysteme
- Lösungsverfahren für Gleichungssysteme mit vielen Unbekannten
Lineare Optimierung
- Graphisches Lösungsverfahren
- Verfahren zur Berechnung der Eckpunkte
- Simplex-Algorithmus
Anwendung der Differentialrechnung
- Extremwertaufgaben
- Ökonomische Funktionen
Finanzmathematik
- Zins- und Zinseszinsrechnung
- Rentenrechnung
Lehrveranstaltung 2: Physik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Mechanik fester Körper
- Basiseinheiten, Gesetze von Newton, Vektoren und Skalare zur Beschreibung physikalischer Größen, grafische Darstellung von Vektoren
- Kraft und Drehmoment
- Rollwiderstand und Reibung
- Arbeit, Energieerhaltung
- Leistung, Wirkungsgrad
Methoden
- Abgrenzung und grafische Darstellung eines statischen Systems, incl. Systemabgrenzung
- Aufstellen und Lösen des beschreibenden Gleichungssystems
- Grafische Kräftebestimmung
Ökologie und Botanik (201-077)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Ökologie
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen der Autoökologie und Wechselbeziehungen zwischen Organismen
- Entwicklungsprozesses in Ökosystemen (Populationsökologie, Evolution)
- Ökologische Interaktionen auf Landschaftsebene (Biotopvernetzung, Landschaftsgefüge)
- Energieflüsse und Stoffkreisläufe (Wasser, Stickstoff, Phosphor, Kohlenstoff)
Lehrveranstaltung 2: Botanik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Anatomie:
- Aufbau pflanzlicher Zellen und Gewebe
- Aufbau der Grundorgane der Pflanzen
- Aufbau metamorpher Organe, insbesondere Organe der vegetativen und generativen Reproduktion
Physiologie:
- Nährstoff- und Wasserhaushalt, Photosynthese, Atmung, Reaktionen auf Umweltreize
- Phytohormone und ihre Funktionen
- Mechanismen der Pollen- und Samenverbreitung
- Grundlagen der botanischen Taxonomie
Genetik und Chemie (201-078)
Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung: 1 Genetik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen im Feld (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen der Mendelschen Genetik und Abweichungen
- Genetische Grundlagen der Tier- und Pflanzenzüchtung
- Genotyp und Umwelt sowie deren Wechselwirkungen
- Wichtige Selektionsmethoden
- Vergleich der verschiedenen Strategien der Tier- und Pflanzenzüchtung
- Verfahren der Bio- und Gentechnologie sowie des Klonens
- Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen
Lehrveranstaltung 2: Chemie
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)
Inhalte
Allgemeine und Anorganische Chemie:
- Thermodynamik und Mechanismen chemischer Reaktionen
- Chemisches Gleichgewicht und Katalyse
- Chemische Bindung
- Redoxvorgänge, Säure-/Basen-Reaktionen und –Gleichgewichte
- Chemie ausgewählter Elemente (z.B. C, N, P, K, O, S) und ihre Kreisläufe in der Biosphäre
Organische und Biologische Chemie:
- Physikalische Eigenschaften organischer Verbindungen
- Nomenklatur organischer Verbindungen und funktionelle Gruppen
- Molekülbau und Reaktivität organischer Verbindungen
- Chemie der Kohlenhydrate, Proteine, Lipide, Nukleinsäuren
AW 2. Semester
Nutztierhaltung (201-056)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung, Übungen, Lehrveranstaltung vor Ort, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
Vorlesungen:
- Entwicklung und Bedeutung der Nutztierhaltung in Deutschland, aktuelle Fragestellungen und Zielkonflikte der Nutztierhaltung (Klima, Wasserhaushalt, Biodiversität, Ernährung der Weltbevölkerung)
- Verhaltensbiologie und daraus resultierende Haltungsansprüche der Nutztiere
- Tierethik, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung, Tierbezogene Indikatoren, Eigenkontrolle nach § 11 Abs. 8 TierSchG, Manipulationen an Tieren
- Stallklima, Klimafaktoren, Bezug zum landwirtschaftlichen Bauwesen/Klimaanpassungsstrategien
- Produktionsverfahren, Leistungsparameter und Dokumentations- bzw. Auswertungssoftware
Übungen in Gruppen, z. B.:
- Beurteilung von Stalleinrichtung hinsichtlich Tier-Technik Interaktionen (z. B. Klauengesundheit, Techno- und Ethopathien)
- Tierbezogene Indikatoren
- Stallklimafaktoren
- Bienen-, Pferde-, Geflügel-, Ziegenhaltung
LVvO oder Exkursionen, z. B.:
- Landesanstalten LSZ Boxberg/LAZBW Aulendorf
- Innovative Stallkonzepte bei Rind und Schwein
- Aquakultur, Pferdehaltung, Bienenhaltung, Geflügelhaltung, Haltung kleiner Wiederkäuer
Grundlagen Pflanzenbau und Grünlandlehre (201-079)
Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Pflanzenbau I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Sozioökonomische Rahmenbedingungen für den Pflanzenbau
- Bodenfruchtbarkeit
- Fruchtfolge
- Bodenbearbeitung
- Nachhaltige Pflanzenproduktionssysteme
- Ertragsbildung von Winterweizen
Lehrveranstaltung 2: Grünlandwirtschaft
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)
Inhalte
Vorlesung:
- Einführung: Geschichte und Status-quo der Grünlandbewirtschaftung, Ziele der Grünlandbewirtschaftung und wesentliche Unterschiede zum Ackerbau
- Ertragsbildung im Grünland
- Management von Wiesen und Weiden (Pflegemaßnahmen, Ernte bei Schnittnutzung, Weidemanagement)
- Arten des Grünlandes
- Bestandsbeurteilung und Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen
Übungen:
- Arten des Grünlandes bestimmen
- Bestandsbeurteilung und Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen
Bodenkunde und Pflanzenernährung (201-080)
Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Bodenkunde
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen im Feld (Präsenz)
Inhalte
- Basiswissen und grundlegende Fertigkeiten in den Bereichen Mineralogie, Bodenbildung, Boden als poröser Körper, Boden als Lebensraum, Boden als Wasser- und Nährstoffspeicher sowie zum Bodenschutz
- Grundprinzipien der Ansprache eines Bodenprofils im Feld
- Durchführung der Fingerprobe und Bestimmung des Kalkgehalts
- Ermittlung der verfügbaren Wassermenge im Boden
- Beschreibung der Bodengüte auf Basis der Bodenschätzungskarte
Lehrveranstaltung 2: Pflanzenernährung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen (Präsenz)
Inhalte
- Aufnahme von Pflanzennährstoffen über Wurzel und Spross, Verteilung der Nährstoffe in der Pflanze
- Bedeutung und Düngung der Makronährstoffe N, P und K
- Bedeutung und Düngung der sekundären Makronährstoffe Ca, S, Mg
- Bedeutung eines geeigneten pH-Werts
- Grundsätzliches zur Bedeutung und Düngung von Mikronährstoffen
- Organische Dünger und Wirksamkeit der organischen Düngung
- Berechnung der notwendigen N, P und K-Düngermenge für eine vorgegebene Situation
- Anwendung der Düngeverordnung
- Berechnung einer N- und P-Bilanz für einen Betrieb
- Abschätzung der Nitratauswaschungsgefahr
- Durchführung von Nmin- und Grundnährstoffuntersuchungen
- Erhebungen des Ernährungszustands von Pflanzenbeständen mit Hilfe des N-Testers und Düngefenstern
Einführung in Nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung (201-081)
Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Ökologie und Nachhaltige Entwicklung in der Praxis
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Stand der Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung mit Fokus auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft
- Diskussion möglicher Agrarsysteme der Zukunft
- Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Landnutzungsstrategien
- Ethische Betrachtungen, z.B. beim Management von Zielkonflikten
Lehrveranstaltung 2: Einführung in die Digitalisierung in der Landwirtschaft
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Zentrale Elemente und Strategien der Digitalisierung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
- Grundlagen der Präzisionslandwirtschaft
- Stand der Technik bei digitalen Entscheidungshilfen auf dem Betrieb und in der Wertschöpfungskette
- Nachhaltige Landwirtschaft durch digitale Entscheidungshilfen
- Technikfolgeabschätzung
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz (201-101)
Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Phytomedizin
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übungen im Feld (Präsenz)
Inhalte
- Geschichte der Phytomedizin & Schadsymptome
- Grundlagen der Taxonomie
- Populationsdynamik; Epidemiologie von Schaderregern &
- Schadschwellenanalyse
- Diagnose von Schaderregern & Abiotische Schadfaktoren
- Biotische Schadorganismen (Viren, Bakterien, Pilze, Tiere (v.a Insekten & Nematoden)
- Krankheitsentstehung, Pathogenitätsfaktoren, Resistenz
Lehrveranstaltung 2: Pflanzenschutz
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übungen im Feld (Präsenz)
Inhalte
- Chemischer Pflanzenschutz (Geschichte des Pflanzenschutzes und Grundlagen der Epidemiologie, Formulierungstechnologie, Herbizide und Resistenzmanagement, Fungizide und Wachstumsregler, Biopestizide und Nützlinge)
- Zulassung, Genehmigung und Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln
- Gute Fachliche Praxis
- Modell-gestützter Pflanzenschutz
- Integrierter Pflanzenschutz und Resistenzmanagement
Praxisprojekt (201-084)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 8 SWS (10 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Einführung Projektmanagement
Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Coaching in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Begriffe, die im Projektmanagement gebräuchlich sind: Projekt, Projektziele, Projektorganisation, Projektmanagement, Auftrag, Arbeitspaket, Projektstrukturplan, Netzplan, Statusbericht
- Funktionen und Aufgaben des Projektmanagements, Aufgaben der Projektleitung, Projektaufbau und -ablauf, Möglichkeiten der Projektorganisation, Methoden und Werkzeuge der Planung von Projekten, Projekt-Controlling
- Grundlagen der Teamarbeit (Kommunikation im Team, Konflikte in der Projektarbeit)
Lehrveranstaltung 2: Rhetorik / Präsentation
Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Rhetorik und Kommunikationstheorie, Redearten
- Elemente rhetorischer Kompetenz: gedankliche Konzeption, sprachliches Ausdrucksvermögen, wirkungsvolle Sprechtechnik, bewusste Körpersprache, mentale Einstellung
- Gesprächsführung
- Strategische Vorbereitung von Vorträgen: z.B. mit Hilfe von Mind Maps, Analyse der Teilnehmer, Kernbotschaften entwickeln, strategisch zuordnen und überzeugend gliedern
- Feinschliffmethode: Treffsichere Formulierungen, Wortschatzerweiterungen, Wort- und Satzstile, Sprechdenken
- Stimmübungen und Sprechtechniken: Aussprache, Betonung, Dialektreduzierung, Zäsuren
- Nonverbale Kommunikationsmittel: Mimik, Bewegung, Blickkontakt
- Mission des Redners und Grundpositionierungen zum Publikum
- Visualisierungsmethoden und Ambiente
- Verbale Angriffs- und Abwehrmethoden
- Bekämpfung von Rede- und Prüfungsangst
- Präsentationstechniken
- Erstellung und Gestaltung von Präsentationen und wissenschaftlichen Postern
Lehrveranstaltung 3: Wissenschaftliches Arbeiten
Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen
- Erstellen von Gliederungen, Form und Format:ieren
- Literaturrecherche und Zitieren, Erstellen von Literatur- und Quellenverzeichnissen
- Erstellen von Graphiken und Tabellen
- Datenanalyse
- Wissenschaftliches Schreiben und Vortragen
Lehrveranstaltungen 4: Projektarbeiten
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Projekt in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
Eine Liste der angebotenen Projektthemen wird rechtzeitig vor Semesterbeginn bereitgestellt, so dass sich die Studierenden jeweils selbstständig in die Projektgruppen von max. 15 Studierenden/Gruppe eintragen können.
Die Inhalte sind im Einzelnen jeweils abhängig vom gewählten Thema der Projektarbeit.
Die Projektbearbeitung erfolgt unter entsprechender Betreuung über zwei Semester (2. und 3. Semester) hinweg. Während der Projektbearbeitungszeit sind 3 Präsentationen und 2 schriftliche Ausarbeitungen zu erstellen:
- Beginn Sommersemester: Projektplanungspräsentation
- Ende Sommersemester: Semesterpräsentation und Zwischenbericht
- Ende Wintersemester Abschlusspräsentation und Projektabschlussbericht
Lehrveranstaltungen 5: Praxisübung
Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)
Format: Übung (Präsenz)
Inhalte
- Die Übungen bestehen in der Durchführung von praktischen Tätigkeiten u.a. in den Lehr- und Versuchsbetrieben der HfWU, im Versuchs- oder Laborwesen etc. Dabei kann es sich z.B. um die Betreuung von Tieren, Versuchsanlagen, Pflanzenparzellen oder andere typische Aufgaben im land- und pferdewirtschaftlichen Betrieb handeln.
- Die Übung hat einen zeitlichen Umfang: von 20 Zeitstunden pro Person. Sie ist je nach Aufgabenstellung geblockt oder über mehrere Wochen verteilt, während des 2. und 3. Semesters, unter fachlicher Anleitung zu absolvieren.
- Die Aufgabenstellungen sind im Einzelnen jeweils abhängig von der gewählten Projektarbeit (s.o.).
AW 3. Semester
Controlling (201-018)
Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Schmid
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Controlling
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)
Inhalte
- Organisation, Ziele, Systematik und Instrumente des Controlling
- Prozess-, Markt- und Preiscontrolling in agrar- und pferdewirtschaftlichen Unternehmen
- Liquiditätscontrolling einschließlich Grundlagen der Finanzplanung und Finanzierung
- Jahresabschlussanalyse, Leistungs-Kostenrechnung und Betriebszweiganalyse in land- und pferdewirtschaftlichen Unternehmen
- Grundlagen der gesamtbetrieblichen Planung
Grundlagen der Agrartechnik (201-019)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen der Agrartechnik
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)
Inhalte
Aufbau mobiler Arbeitsmaschinen, insbesondere Ackerschlepper:
- Antriebsstrang (Antriebsquelle, Fahrgetriebe)
- Fahrwerk
- Mechanischer und hydraulischer Geräteantrieb
- Geräteanbau, Anhängevorrichtungen
- Elektronische Steuer- und Regeleinrichtungen
Betriebsverhalten:
- Zugkraftübertragung, Fahrwiderstände und Rad-Boden-Interaktion
- Krafteinleitung und Lastverteilung
- Dieselmotorvollastkennlinie, Motorkennfeld, Kraftstoffverbrauch
- usammenspiel Motor-Getriebe-Fahrwerk
- Hydraulikanlagen
Für das Verständnis der Funktion von Motoren und Getrieben stehen im Institut für Technik eine Vielzahl von Anschauungs- und Schnittmodellen zur Verfügung, die im Rahmen der Übungen in kleinen Gruppen erläutert werden. Für das Verständnis physikalisch-technischer Zusammenhänge und das Gesamtsystem werden Messungen an und mit Traktoren im Rahmen der Übungen durchgeführt.
Technik der Innenwirtschaft (201-021)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Technik der Innenwirtschaft - Vorlesung
Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)
Format: Vorlesung, LVvO und Exkursionen (Präsenz)
Inhalte
- In Lernteams wird ein Forschungszyklus durchlaufen und selbstständig nach theoretisch und praktisch gehaltvollen Lösungen für selbst gewählte und praxisrelevante Fragestellungen gesucht. Dabei werden Wechselwirkungen zwischen Tier und Technik berücksichtigt und ökonomische Grundsätze angewandt, benötigte HintergrundinFormat:ionen werden auf gängigen Portalen selbständig recherchiert
- Verfahrensvergleich zur Investition in ein Technikangebot (Digitalisierung/Automatisierung) an einem Fallbeispiel, Technikangebot im Bereich der Routinearbeiten auf nutztierhaltenden Betrieben
- Im LehrFormat: Forschendes Lernen wird in Kleingruppen von 3-6 Studierenden gearbeitet, Nutzung der E-Learning-Plattform Ilias
Lehrveranstaltung 2: Technik der Innenwirtschaft – Übung
Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)
Format: Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Tier-Technik-Interaktionen (z.B. Melkbedingungen, Technopathien)
- Energieverbrauch und Wirkungsgrad
Tierzucht und Tiergesundheitslehre I (201-082)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Tierzucht I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen der Züchtung
- Zuchtziel, Leistungsprüfung, Zuchtwert und Zuchtwertschätzung
- Züchterische Berechnungen zur Populationsgenetik, der Inzucht und dem Zuchtfortschritt
- Veränderungen im Erbgefüge und deren Anwendung und Auswirkungen in Zuchtkonzepten
- Zuchtmethoden
- Neueste Technologien der Tierzucht
Lehrveranstaltung 2: Tiergesundheitslehre I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalt
- Krankheitsursachen und ihre Bedeutung für die Tiergesundheit
- Hygienekonzepte für verschiedene Tierhaltungssysteme
- Hygienekonzepte und Handlungsschritte zur Verhinderung der Erregerverschleppung
- Anzeigepflichtige Seuchen, rechtliche Hintergründe
- Funktionsweise des Immunsystems und Wirkung von Impfstoffen
- Arzneimittelrecht
- Antibiotikagruppen und deren Anwendung
Tierernährung und Futtermittelkunde I (201-083)
Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Tierernährung I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Weender und erweiterte Weender Futtermittelanalyse
- Aufbau und Verwertung von Nährstoffen (Fett, Protein, Kohlenhydrate)
- Verdauungsphysiologie
- Scheinbare und wahre Verdaulichkeit
- Energiebewertung
- Futtermittelrecht (Gesetze und Verordnungen)
Lehrveranstaltung 2: Futtermittelkunde I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Unterscheidung Grob-, Saft- und Kraftfutter
- Bestimmungsübungen energie- und proteinreiche Futtermittel
- Rangierung energie- und Proteinreiche Futtermittel
- Bestimmungsübungen Grobfutter
- Energieberechnung Grobfutter
- Rationsformulierung Milchkuh
Praxisprojekt (201-084)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 8 SWS (10 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Einführung Projektmanagement
Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Coaching in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Begriffe, die im Projektmanagement gebräuchlich sind: Projekt, Projektziele, Projektorganisation, Projektmanagement, Auftrag, Arbeitspaket, Projektstrukturplan, Netzplan, Statusbericht
- Funktionen und Aufgaben des Projektmanagements, Aufgaben der Projektleitung, Projektaufbau und -ablauf, Möglichkeiten der Projektorganisation, Methoden und Werkzeuge der Planung von Projekten, Projekt-Controlling
- Grundlagen der Teamarbeit (Kommunikation im Team, Konflikte in der Projektarbeit)
Lehrveranstaltung 2: Rhetorik / Präsentation
Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Rhetorik und Kommunikationstheorie, Redearten
- Elemente rhetorischer Kompetenz: gedankliche Konzeption, sprachliches Ausdrucksvermögen, wirkungsvolle Sprechtechnik, bewusste Körpersprache, mentale Einstellung
- Gesprächsführung
- Strategische Vorbereitung von Vorträgen: z.B. mit Hilfe von Mind Maps, Analyse der Teilnehmer, Kernbotschaften entwickeln, strategisch zuordnen und überzeugend gliedern
- Feinschliffmethode: Treffsichere Formulierungen, Wortschatzerweiterungen, Wort- und Satzstile, Sprechdenken
- Stimmübungen und Sprechtechniken: Aussprache, Betonung, Dialektreduzierung, Zäsuren
- Nonverbale Kommunikationsmittel: Mimik, Bewegung, Blickkontakt
- Mission des Redners und Grundpositionierungen zum Publikum
- Visualisierungsmethoden und Ambiente
- Verbale Angriffs- und Abwehrmethoden
- Bekämpfung von Rede- und Prüfungsangst
- Präsentationstechniken
- Erstellung und Gestaltung von Präsentationen und wissenschaftlichen Postern
Lehrveranstaltungen 3: Wissenschaftliches Arbeiten
Umfang: 1,1 SWS (1,375 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
- Wissenschaftstheoretische Grundlagen
- Erstellen von Gliederungen, Form und Format:ieren
- Literaturrecherche und Zitieren, Erstellen von Literatur- und Quellenverzeichnissen
- Erstellen von Graphiken und Tabellen
- Datenanalyse
- Wissenschaftliches Schreiben und Vortragen
Lehrveranstaltungen 4: Projektarbeiten
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Projekt in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
Eine Liste der angebotenen Projektthemen wird rechtzeitig vor Semesterbeginn bereitgestellt, so dass sich die Studierenden jeweils selbstständig in die Projektgruppen von max. 15 Studierenden/Gruppe eintragen können.
Die Inhalte sind im Einzelnen jeweils abhängig vom gewählten Thema der Projektarbeit.
Die Projektbearbeitung erfolgt unter entsprechender Betreuung über zwei Semester (2. und 3. Semester) hinweg. Während der Projektbearbeitungszeit sind 3 Präsentationen und 2 schriftliche Ausarbeitungen zu erstellen:
- Beginn Sommersemester: Projektplanungspräsentation
- Ende Sommersemester: Semesterpräsentation und Zwischenbericht
- Ende Wintersemester Abschlusspräsentation und Projektabschlussbericht
Lehrveranstaltungen 5: Praxisübung
Umfang: 0,9 SWS (1,125 ECTS)
Format: Übung (Präsenz)
Inhalte
- Die Übungen bestehen in der Durchführung von praktischen Tätigkeiten u.a. in den Lehr- und Versuchsbetrieben der HfWU, im Versuchs- oder Laborwesen etc. Dabei kann es sich z.B. um die Betreuung von Tieren, Versuchsanlagen, Pflanzenparzellen oder andere typische Aufgaben im land- und pferdewirtschaftlichen Betrieb handeln.
- Die Übung hat einen zeitlichen Umfang: von 20 Zeitstunden pro Person. Sie ist je nach Aufgabenstellung geblockt oder über mehrere Wochen verteilt, während des 2. und 3. Semesters, unter fachlicher Anleitung zu absolvieren.
- Die Aufgabenstellungen sind im Einzelnen jeweils abhängig von der gewählten Projektarbeit (s.o.).
AW 4. Semester
Praktisches Studiensemester (201-102)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 25 ECTS
Prüfung: Schriftlicher Praktikumsbericht
Lehrveranstaltung 1: Praktisches Studiensemester
Umfang: 24 SWS (25 ECTS)
Format: Pflichtpraktikum
Inhalte
Während des Praxissemesters auf einem landwirtschaftlichen Betrieb (mit oder ohne Pferdehaltung), einer Organisation oder einem Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft sollen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in den einzelnen Betriebsabläufen erworben werden. Diese richten sich nach dem gewählten Praktikumsplatz, müssen aber den Richtlinien zum Praktischen Studiensemester entsprechen.
Praxismodul (201-103)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 5 ECTS
Prüfung: Teilnahmebescheinigung
Lehrveranstaltung 1: Praxismodul
Umfang: 5 ECTS
Format: Praktikum
Inhalte
- Erfolgreiche Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der land- oder pferdewirtschaftlichen Praxis (z.B. Schweißkurse, Baumschnittkurse, Kurse zur Maschinenbedienung etc.)
- Insgesamt muss die Teilnahme an 8 Kurstagen nachgewiesen werden
AW 5. Semester
Ökonomik der Produktion (201-022)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (60 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Ökonomik der Produktion
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung (3 SWS) mit Übung in Gruppen (1 SWS) (Präsenz)
Inhalte
- Begriffe und Methoden der Leistungs-Kostenrechnung sowie weitergehende betriebswirtschaftliche Kalkulationen
- Bedeutung und Entwicklungstendenzen der landwirtschaftlichen Produktion
- Bestimmungsfaktoren der Wirtschaftlichkeit pflanzlicher Produktionsverfahren
- Wirtschaftlichkeitsfragen in Teilbereichen der pflanzlichen Produktion
- Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Marktfrüchte und des Futterbaus
- Bestimmungsfaktoren der Wirtschaftlichkeit von Produktionsverfahren der tierischen Erzeugung
- Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Rinder- und Schweine- und Geflügelhaltung
Im Rahmen einer begleitenden Studienarbeit analysieren die Studierenden ausgewählte Produktionsverfahren und/oder Investitionsvorhaben landwirtschaftlicher Praxisbetriebe.
Angewandte Ökologie (201-027)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (45 Minuten) und schriftliche Arbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Ökologischer Landbau I
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Ursprünge, Leitbilder und Entwicklungsgeschichte des ökologischen Landbaus sowie aktueller Umfang: und Struktur ökologischer Erzeugung
- Ökologischer Pflanzenbau: Nährstoffmanagement im ökologischen Betrieb (insbesondere N-Bindung über Leguminosen, Fruchtfolgegestaltung, Einsatz von Wirtschafts- und Handelsdüngern) und Pflanzengesundheitsmanagement (Präventive Maßnahmen, mechanische Unkrautkontrolle, im Ökolandbau zugelassene mineralische und biologische Verfahren des Pflanzenschutzes)
- Ökologische Tierhaltung: Unterschiede zur konventionellen Haltung in Bezug auf Haltung, Fütterung, Zucht, Gesundheitsmanagement und deren praktische Implikationen
- Zertifizierungs- und Kontrollsystem (nach EU-Verordnung sowie für Verbandsware); Profil der Bioverbände
Lehrveranstaltung 2: Agrarökologie
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Vorlesung:
- Beeinträchtigungen der Bodenfunktion: Vermittlung theoretischer Grundlagen zur Durchführung von Bodengefügeansprachen im Feld
- Nährstoffausträge in die Umwelt: Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen, Schadwirkungen der Emissionen in der Umwelt, Maßnahmen zur Emissionsvermeidung
- Treibhausgasemissionen: Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen, Folgen des Klimawandels, Mitigationsmaßnahmen
- Biodiversitätswirkungen: Status-quo des Biodiversitätsrückgangs und dessen Ursachen, Gründe für den Erhalt der biologischen Vielfalt; exemplarische Darstellung von Fördermaßnahmen inklusive Förderprogrammen
Übung:
- Die Studierenden erstellen schriftliche Ausarbeitungen zu vorgegebenen Aufgaben. Dazu sind eigene Literaturrecherchen, Literaturauswertungen und Berechnungen erforderlich. Soweit möglich wird mindestens eine Übung praktisch im Feld durchgeführt.
Marketing (201-030)
Verantwortlich: Prof. Dr. André Bühler
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Referat/Präsentation
Lehrveranstaltung 1: Marketing
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz), wahlweise in Deutsch oder Englisch
Inhalte
- Grundbegriffe und Grundlagen des Marketing
- Marketing-Management-Prozess
- Analyse der externen und internen Umwelt, inkl. Analyseinstrumente
- Strategische Unternehmens- und Marketingplanung
- Marketing Mix, insbesondere Produktpolitik (Produktentscheidungen, Produktlebenszyklus, Produktportfolio-Analyse, Markenaufbau und Markenpflege)
Die Veranstaltung wird in deutscher und englischer Sprache angeboten.
Steuern und Recht (201-057)
Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Steuerlehre
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Definition und Belastungshöhe der Steuer
- Grundzüge der Einkommens- und Körperschaftsteuer
- Abgrenzung Land- und Forstwirtschaft sowie Gewerbebetrieb
- Grundzüge der Erbschaftsteuer;
- Grundzüge der Umsatzsteuer;
- Weitere im landwirtschaftlichen Bereich relevante Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer etc.)
- Umgang mit den Finanzbehörden
- Unternehmenssteuern und Lohnsteuer
- Hofübergabevertrag und GbR-Vertrag
Lehrveranstaltung 2: Agrarrecht
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
- Allgemeine Rechtsgrundsätze, Gerichtsbarkeiten, Gewohnheitsrecht, Rechtsanwendung
- Grundlagen des öffentlichen Rechts (Recht der Europäischen Union, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht)
- Grundlagen des Privatrechts (Handels- und Gesellschaftsrecht)
- Grundlagen des landwirtschaftlichen Fachrechts (z.B. Grundstückverkehrsgesetz, Höfeordnung und landwirtschaftliches Erbrecht, Landpacht- und Landpachtverkehrsgesetz, Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Dünge- und Pflanzenschutzrecht, Kooperationen in der Landwirtschaft)
- Grundlagen des Umweltrechts (z.B. Immissionsschutzrecht, Bodenschutz-, Tierschutz- und Naturschutzrecht, Umweltverfahrensrecht)
Investition und Finanzierung (201-059)
Verantwortlich: Prof. Dr. Jürgen Braun
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Investition und Finanzierung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Begriffsbestimmung
- Grundzüge der Finanzmathematik
- Grundsatzfragen Finanzierung
- Kreditsicherheiten
- Finanzierungsinstrumente
- Methoden der statischen und dynamischen Investitionsrechnung
Lehrveranstaltung 2: Betriebsentwicklungsplanung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Entwicklungsplanung:
- Datenerfassung und -aufbereitung
- Erstellung des Modellansatzes
- Anwendung Planungsmethoden (Betriebsvoranschlag, Programmplanung I und II)
Anforderungen und Einsatzgebiet eines Businessplans
Aufbau und Inhalt eines Businessplans
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Wahlmodule Wintersemester.
AW 6. Semester
Projektmodul (201-029)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 2 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Projektmodul
Umfang: 2 SWS (5 ECTS)
Format: Projekt mit begleitendem Coaching durch die jeweiligen Projektverantwortlichen (Präsenz)
Inhalte
- Anwendung der Grundlagen des Projektmanagements und des wissenschaftlichen Arbeitens auf eine fachbezogene oder interdisziplinäre Projektaufgabe aus dem Bereich der Land- und Pferdewirtschaft, die als Gruppenarbeit von jeweils max. 15 Studierenden zu bearbeiten ist
- Die möglichen Projektthemen werden rechtzeitig vor Beginn des Semesters bekannt gegeben und zur Wahl gestellt
- Die Inhalte der einzelnen Projektarbeiten sind abhängig von der jeweils gestellten Projektaufgabe
Technik der Außenwirtschaft (201-033)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Technik der Außenwirtschaft
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Aufbau von Maschinen und Geräten für den Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung:
- Bodenbearbeitung und Aussaat
- Bestandspflege, insbesondere Pflanzenschutz
- Düngung
- Ernte von Körnerfrüchten und Halmgut
- Landwirtschaftlicher Güterumschlag und Logistik
Betriebsverhalten:
- von Bodenbearbeitungsgeräten
- von Sägeräten
Methoden:
- Physikalisch-technische Messungen und Untersuchungen an Maschinen und Geräten
- Berechnung des Arbeitszeitbedarfs
- Ermittlung des Traktorleistungsbedarfs
- Kalkulation von Verfahrenskosten
Pflanzenproduktionssysteme (201-058)
Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Pflanzenproduktionssysteme
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
Vorlesung:
- Treiber der Pflanzenproduktionssysteme heute und in der nahen Zukunft (2035)
- Grundlagen des Speziellen Pflanzenbaus zu Kulturen, die im Südwesten Deutschlands derzeit im Anbau sind bzw. aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten angebaut werden könnten
Gruppenarbeit mit jeweils 5 Studierenden:
- Recherche von seriösen InFormat:ionen für die Praxis und Beratung
- Befragung von Fachleuten (Landwirt*in, Berater*in Firmenvertreter*in)
- Schriftliche und mündliche Präsentation der Rechercheergebnisse für eine Kultur in einem konkreten Betrieb
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 1 & 2.
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 1 & 2.
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Wahlmodule Sommersemester.
AW 7. Semester
Marktlehre und Agrarpolitik (201-060)
Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Agrar- und Umweltpolitik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Aufgaben und Gestaltung von Agrar- und Umweltpolitik sowie deren gesellschaftspolitische Einordnung und Beurteilung:
- Wissenschaftliche und praktische Agrarpolitik
- Gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft
- Träger und Ziele der Agrarpolitik
- Agrarpolitische Instrumente in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen
- Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen
- Umwelt als ökonomisches und öffentliches Gut
- Maßnahmen der Umweltpolitik und deren Bewertung
- Bedeutung externer Effekte
Lehrveranstaltung 2: Marktlehre und Agrarhandel
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung (Präsenz)
Inhalte
Einführung:
- Agrarmärkte und Globalisierung
- Marktordnungsinstrumente in der EU
- Bedeutung des Agribusiness
Was sind Märkte?
- Wie funktionieren sie?
- Beurteilung von Eingriffen in den freien Markt
- Gerechte Preise
- Methoden der Markanalyse
Entwicklungen auf den wichtigsten Agrarmärkten:
- Getreide
- Fleisch
- Milch
- Boden
Warenterminmärkte
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 3 & 4.
Die jeweiligen Inhalte finden Sie unten bei Vertiefungsmodul 3 & 4.
Bachelorarbeit (201-053)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 12 ECTS
Prüfung: Bachelorarbeit (4 Monate)
Lehrveranstaltung 1: Bachelorarbeit
Umfang: 4 Monate Bearbeitungszeit (12 ECTS)
Format: Schriftliche Abschlussarbeit
Inhalte
Vertiefte, selbständige, wissenschaftliche Bearbeitung einer in Absprache mit den Betreuenden festgelegten spezifischen Fragestellung aus dem weiteren Bereich der Agrarwirtschaft innerhalb einer vorgegebenen Frist.
Bei Literaturarbeiten ist der jeweilige Stand der Forschung sach- und adressatengerecht nach wissenschaftlichen Standards zu verdichten. Wenn eigene empirische Analysen durchgeführt werden, sind angemessene Daten zu erheben und mittels geeigneter Methoden auszuwerten. Bei Arbeiten in Zusammenarbeit mit der Praxis geht es in erster Linie darum, ein konkretes Problem durch das Anwenden wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu lösen.
Dabei lernen sie die Studierenden unter anderem:
- Zusammenhänge und Verflechtungen kennen und interdisziplinär zu betrachten
- Themen und Fragen in internationalen wissenschaftlichen Medien zu recherchieren
- Themenfelder abzugrenzen und zu strukturieren
- erworbenes Wissen anzuwenden, bzw. auf eine neue Thematik zu übertragen
- wissenschaftliche Versuche mit entsprechender Vorgehensweise durchzuführen
- Informations- und Datensätze zu analysieren und zu bewerten
- die Ergebnisse in wissenschaftlich korrekter Form schriftlich niederzulegen.
Mündliche Bachelorprüfung (201-071)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 3 ECTS
Prüfung: Mündliche Prüfung (30 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Mündliche Bachelorprüfung
Umfang: 3 ECTS
Format: Präsentation mit Diskussion
Inhalte
Präsentation von Problemstellung, Zielsetzung, methodischer Vorgehensweise und Ergebnissen der Bachelorarbeit mit anschließender Diskussion von Fragen zur Bachelorarbeit sowie zu agrarwirtschaftlichen Themen, die mit der Arbeit in Verbindung stehen.
Vertiefungsmodul 1 & 2
Vertiefungsrichtung Agrarumweltmanagement
Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion (201-090)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung, Fallstudien und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft
- Aktuelle Fragen des ökologischen Pflanzenbau
Übungen in Pflanzen- und Tierbestimmung (201-093)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Botanische Bestimmungsübungen
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Übung im Labor und Feld (Präsenz)
Inhalte
- Taxonomische Grundlagen der Pflanzenbestimmung
- Typische Merkmale wichtiger Pflanzenfamilien
- Umgang mit Bestimmungsliteratur
- Einblicke in die Vegetationsökologie
Lehrverstaltung 2: Faunistisch Bestimmungsübungen
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Übung im Labor und Feld (Präsenz)
Inhalte
- Einführung: Von der Zelle zur Biodiversität
- Stämme des Tierreichs
- Gliedertiere der Agrarlandschaft
- Keschern und Feldübungen mit Bestimmungsschlüsseln und Apps
- Bestimmungsübungen im Labor
Vertiefungsrichtung Pflanzenproduktion
Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion (201-090)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (45 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Umweltgerechte und ökologische Pflanzenproduktion
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung, Fallstudien und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft
- Aktuelle Fragen des ökologischen Pflanzenbau
Automatisierte Maschinen in der Pflanzenproduktion (201-091)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Automatisierte Maschinen in der Pflanzenproduktion
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
Grundlegende Technologien:
- Ortungs- und Navigationssysteme in der Landwirtschaft
- Maschinenkommunikation
- Physikalische Grundlagen der Sensortechnik
- Ausführungen von Sensoren und Aktoren
- Bildgebende Systeme
- Datenverarbeitung und -verwaltung
Anwendungen:
- Automatische Fahrzeugführungen auch im Zusammenhang spezieller Verfahrenstechniken wie zum Beispiel Controlled Traffic Farming oder Strip Till
- Mess- und Automatisierungssysteme im landwirtschaftlichen Produktionsprozess inklusive landwirtschaftlicher Logistik
- Roboter / neue Maschinenkonzepte
Methoden:
- Physikalisch-technische Messungen und Untersuchungen an Maschinen und Geräten
- Experimente zur Datenverarbeitung und Verwaltung
Vertiefungsrichtung Tierische Erzeugung
Tierzucht und Tiergesundheitslehre II (201-086)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Tierzucht II
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen der Tierzucht und Zuchtarbeit im Betrieb
- Moderne Zuchtarbeit bei Rind und Schwein
- Zuchtentscheidungen auf Basis ausgewerteter Daten
- Zuchtkatalogen und Anpaarungsplanung
- Grundzüge der Tierbeurteilung beim Rind
Lehrveranstaltung 2: Tiergesundheitslehre II
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Hauptkrankheitsursachen bei Schwein und Wiederkäuer
- Hygiene- und Prophylaxemaßnahmen für unterschiedliche Betriebskonzepte
- Arzneimittelanwendung und Umgang mit Antibiotika, Wirkweise von Impfstoffen, Arzneimittelrecht
- Anzeigepflichtige Tierseuchen
Herdenmanagement und Digitalisierung (201-087)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Mündliche Prüfung (10 Minuten) und schriftliche Arbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Herdenmanagement
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Seminaristischer Unterricht, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Anwendung softwaregestützter Entscheidungshilfesystemen
- Herdenmanagementsoftware, z.B. LKV Herdenmanager, Herde, Melktechnikfirmen
- Analyse eines Fallbeispiels (nutztierhaltender Betrieb) mit Schwachstellenanalyse
- Entwicklung von Optimierungsansätzen, deren Bewertung und Integration einer sinnvollen betrieblichen Eigenkontrolle nach § 11 Abs. 8 TierschG
Lehrveranstaltung 2: Digitalisierung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Seminaristischer Unterricht, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Softwaregestützte Werkzeuge und Methoden zur Analyse und Modellierung der Prozessabläufe in der tierischen Produktion
- Kenntnisse relevanter Sensorsysteme in den Bereichen Tieridentifikation und –verhalten, Haltungssysteme, Stallklima, Füttern, Entmisten und Emissionen
- Selbstlernende Systeme (KI) beispielsweise zur Krankheitsfrüherkennung oder Stallklimasteuerung
- Intelligente Steuerungssysteme zur Koordination unterschiedlicher Automatisierungstechnik (z.B. Lüftungs- und Einstreusystem)
Vertiefungsmodul 3 & 4
Vertiefungsrichtung Agrarumweltmanagement
Nutztierhaltung und Umwelt (201-089)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung und Umwelt
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Emissionen und Immissionen von Tierhaltungsanlagen, z.B. Richtlinie VDI 3894, Gute Fachliche Praxis der Ammoniak-Emissionsminderung in der Landwirtschaft, Konventionswerte für Emissionsfaktoren von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub, organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen zur Emissionsminderung, Situation in anderen Ländern (z.B. CH, DK, NL)
- Bewertung von Emissionsminderungsmaßnahmen, z.B. Simulation von Szenarien zur Verringerung von Ammoniakemissionen aus der Rinderhaltung (Milch und Mast) und zur Optimierung des CO2-Footprint und des Life Cycle Index (LCI) bzw. Life Cycle Assessment (LCA) von Milch; Anwendung von EDV-Programmen zur Simulation von Umweltwirkungen
- Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren (KTBL), Tierschutzindikatoren
- Zukunftsfähiges landwirtschaftliches Bauwesen, Anpassungsstrategien an Klimaextreme
- Ökologische Tierhaltung (Leitbilder, praktische Umsetzung in den unterschiedlichen Agrarregionen Baden-Württembergs)
- Spezielle Aspekte der Tiergesundheit, z.B. Erkrankungen bei gemeinsamer Weidehaltung insbesondere Parasitenmanagement
- Spezielle Aspekte des Tierwohls, z.B. kuhgebundene Kälberaufzucht, Anforderungen des LEH/der Molkereien, Herausforderungen von Einnutzungsrassen, Gruppenhaltung, Freigeländezugang inkl. Weidehaltung
- Spezielle Aspekte des Futters und der Fütterung und deren Auswirkungen auf die Gesamtumweltwirkung der Nutztierhaltung: Zusammenhang Futter und Fütterung zu Ausscheidungen und Emissionen, Umweltverträgliche Futter- und Fütterungskonzepte
- Exkursion zu innovativen Praxisbetrieben mit konventioneller und ökologischer Bewirtschaftung und innovativen Stallbaukonzepten, Besichtigung von Landschaftspflegemodellen bzw. Urzeitweide
Landschaftspflege und -entwicklung (201-098)
Verantwortlich: Prof. Dr.-Ing. Albert Stoll
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Landschaftspflege und -entwicklung
Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Organisation der Naturschutzverwaltung in Baden-Württemberg (Zuständigkeiten, Fördermittel, Voraussetzungen zur Teilnahme, Landschaftserhaltungsverbände)
- Arten der Grünlandpflege, Nutzungsaspekte (Zeitpunkt, Frequenz, Düngung), standörtliche und naturschutzfachliche Konsequenzen
- Zweinutzungssysteme am Beispiel Streuobst (naturschutzfachliche Bedeutung, aktuelle Situation in Süddeutschland, Best Practice-Beispiele)
- Pflege von Feldgehölzen und -hecken im Offenland (Notwendigkeit der Pflege, Vorgehensweise, Kriterien für eine naturschutzfachlich optimierte Heckenpflege)
Lehrveranstaltung 2: Landschaftspflegetechnik
Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Fahrzeugkonzepte und mobile Arbeitsmaschinen in der Landschaftspflege (Traktoren und Geräteträger, Raupenfahrzeuge, Amphibien- und Wasserfahrzeuge)
- Grundlagen der Antriebstechnik (2-Takt und 4-Takt-Motoren sowie Elektroantriebe)
- Verfahrenstechnik für Grünflächenpflege (Mähen/Mulchen, Schwaden, Bergen), Gehölzschnitt und Gehölzzerkleinerung (handgeführte Geräte, Forstmaschinen, Hacker), Gewässer- und Grabenpflege
- Transporttechnik
- Arbeitswirtschaftliche Bewertungen
Vertiefungsrichtung Pflanzenproduktion
Obst- und Gemüsebau (201-047)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Obst- und Gemüsebau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Standortansprüche im Gemüsebau, Status-Quo des Gemüsebaus in Deutschland
- Produktionsverfahren im Gemüsebau in Gegenüberstellung zum Ackerbau
- Spezielle Themen des Gemüsebaus, insbesondere Verfrühung und Unterglasanbau, Pflanzenschutz und Nützlinge, Bewässerung, Düngung im Gemüsebau, Erntetechniken
- Standortansprüche im Obstbau, Status-quo des Obstbaus in Deutschland
- Überblick über die Produktionsverfahren im Kernobst-, Steinobst- und Beerenobstanbau
- Wechselnde aktuelle Sonderthemen im Obstbau, z.B. „Alte Sorten“
Pflanzengesundheitsmanagement (201-092)
Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Mündliche Prüfung (10 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Pflanzengesundheitsmanagement
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Gruppenarbeit und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Aktuelle gesellschaftliche Anforderungen an einen nachhaltigen Pflanzenschutz
- Einfluss moderner Kulturführung auf die Phytomedizin, Effekte durch Klimawandel und invasive Arten
- Einführung in Systemdenken/vernetztes Denken
- Aktuelle Entwicklungen im Feld des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzes und der Resistenzzüchtung, Resistenzentwicklung und ihr Einfluss auf die Intensivlandwirtschaft
- Pflanzenschutzstrategien im konventionellen, integrierten und ökologischen Anbau;
- „Smart Farming“ – Relevanz der digitalen Landwirtschaft für ein nachhaltigeren Pflanzenschutz
- Status Quo moderner Formulierungs- und Applikationstechnologien
- Fortschritte auf dem Feld der biologischen Schädlingsbekämpfung und der mechanischen Unkrautregulierung
- Rolle der Agrarlandschaft bei der Vorbeugung und Kontrolle von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten
Vertiefungsrichtung Tierische Erzeugung
Nutztierhaltung und Umwelt (201-089)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Nutztierhaltung und Umwelt
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Emissionen und Immissionen von Tierhaltungsanlagen, z.B. Richtlinie VDI 3894, Gute Fachliche Praxis der Ammoniak-Emissionsminderung in der Landwirtschaft, Konventionswerte für Emissionsfaktoren von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub, organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen zur Emissionsminderung, Situation in anderen Ländern (z.B. CH, DK, NL)
- Bewertung von Emissionsminderungsmaßnahmen, z.B. Simulation von Szenarien zur Verringerung von Ammoniakemissionen aus der Rinderhaltung (Milch und Mast) und zur Optimierung des CO2-Footprint und des Life Cycle Index (LCI) bzw. Life Cycle Assessment (LCA) von Milch; Anwendung von EDV-Programmen zur Simulation von Umweltwirkungen
- Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltungsverfahren (KTBL), Tierschutzindikatoren
- Zukunftsfähiges landwirtschaftliches Bauwesen, Anpassungsstrategien an Klimaextreme
- Ökologische Tierhaltung (Leitbilder, praktische Umsetzung in den unterschiedlichen Agrarregionen Baden-Württembergs)
- Spezielle Aspekte der Tiergesundheit, z.B. Erkrankungen bei gemeinsamer Weidehaltung insbesondere Parasitenmanagement
- Spezielle Aspekte des Tierwohls, z.B. kuhgebundene Kälberaufzucht, Anforderungen des LEH/der Molkereien, Herausforderungen von Einnutzungsrassen, Gruppenhaltung, Freigeländezugang inkl. Weidehaltung
- Spezielle Aspekte des Futters und der Fütterung und deren Auswirkungen auf die Gesamtumweltwirkung der Nutztierhaltung: Zusammenhang Futter und Fütterung zu Ausscheidungen und Emissionen, Umweltverträgliche Futter- und Fütterungskonzepte
- Exkursion zu innovativen Praxisbetrieben mit konventioneller und ökologischer Bewirtschaftung und innovativen Stallbaukonzepten, Besichtigung von Landschaftspflegemodellen bzw. Urzeitweide
Tierernährung und Futtermittelkunde II (201-088)
Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Tierernährung II
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Versorgungsempfehlungen der GfE, DLG und der Länder
- DLG-Futterwerttabellen lesen und verstehen
- Rationsberechnung und Futteroptimierung (händisch und mittels EDV-Programmen)
- Berechnung Nährstoffströme (N-/P-Salden der Fütterungsstrategien)
- Stoffwechselerkrankungen bei Schwein, Rind und Pferd
- Optimierung der Gesamtumweltwirkung (LCA) und des CO2-Fußabdrucks der Nutztierfütterung
Lehrveranstaltung 2: Futtermittelkunde II
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Futtermittelbestimmung
- Einsatz
- Fütterungsempfehlungen
- Preiswürdigkeitsberechnungen
- Unerwünschte Inhaltsstoffe
Wahlmodule Wintersemester
Qualitätsbestimmung und Verarbeitung tierischer Produkte (201-040)
Verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Schneider
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Qualitätsbestimmung tierischer Produkte
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Bedeutung von Lebensmitteln tierischer Herkunft, Verbraucheransprüche
- Konventionelle und innovative/alternative Untersuchungsmethoden
- Milch: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte – Praktische Untersuchungen zur Beurteilung der Milch als Qualitäts- und Servicemerkmal (Fett, Eiweiß, Zellzahlen, Keimgehalt, Progesterongehalt)
- Schlachtkörper und Fleisch: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte - Praktische Untersuchungen zur Beurteilung der Schlachtkörper- und Fleischqualität (Fett- und Muskelanteile, Wasserbindevermögen, pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (Organoleptischer Test von Fleischproben - Testessen)
- Eier: Bedeutung, Produktion, ernährungsphysiologische Aspekte - Untersuchungen der inneren und äußeren Eiqualität
- Honig: Bedeutung, Produktion, Sorten, ernährungsphysiologische Aspekte - Qualitätsmerkmale, Verkostung von Proben
- Felle, Häute: Bedeutung, Produktion, Verarbeitung/Herstellung (Gerbung) – Differenzierungs- und Qualitätsmerkmale
Lehrveranstaltung 2: Verarbeitung tierischer Produkte
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Vor dem Hintergrund, dass mehr als 50% der produzierten Milch- und Fleischmengen nicht als Frischware, sondern als Verarbeitungsware auf den Markt kommen, sollen im Rahmen der Lehrveranstaltung die Verarbeitungsverfahren von Milch zu Käse und Butter sowie von Fleisch zu Wurstwaren erläutert werden
- In diesem Zusammenhang werden auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung und Vermarktung tierischer Produkte (z.B. für die Direktvermarktung) behandelt
Unternehmensführung (201-061)
Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (60 Minuten) und Studienarbeit (40/60)
Lehrveranstaltung 1: Personalführung
Umfang: 1 SWS (1,25 ECTS)
Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)
Inhalte
- Führungsstile und -theorien
- Kommunikation und Konfliktlösung
- Teambildung und Teamführung
- Motivation und Mitarbeiterengagement
- Coaching und Mentoring
- Empathie und soziale Kompetenzen
Lehrveranstaltung 2: Unternehmensplanspiel General Management
Umfang: 3 SWS (3,75 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung in Gruppen (Präsenz)
Inhalte
Unternehmensplanspiel Topsim – General Management:
- Virtuelle Gesamtgeschäftsführung eines Unternehmens in einem Unternehmensplanspiel über mehrere Perioden
- Agieren wie „wirkliche“ Unternehmen im Wettbewerb zwischen studentischen Gruppen
- Analyse Umfang:reicher Umfeld- und Unternehmensdaten und -berichte
- Entscheidungen für wesentliche Unternehmensbereiche treffen
- Controlling und Personalplanung
- Internes und externes Rechnungswesen
Bildung und Beratung (201-068)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (180 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen Bildung und Beratung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)
Inhalte
- Grundbegriffe von Bildung und Bildungsarbeit
- Theorien und Ansätze zur Bildung im (geschichtlichen) Überblick
- Alters- und Entwicklungsstufen und die Besonderheiten der Arbeit mit Jugendlichen
- Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen
- Berufsbildung und Weiterbildung in den grünen Berufen in Baden-Württemberg; Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen
- Definition von Beratung und Abgrenzung zur Bildung bzw. Erwachsenenbildung
- Beispiele aus aktuellen Bildungsthemen
Lehrveranstaltung 2: Berufs- und Arbeitspädagogik
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden entsprechend ihrer berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse Auszubildende im Bereich der „Grünen Berufe“ gemäß Berufsbildungsgesetz ausbilden. Dies beinhaltet insbesondere das Planen, Durchführen und Abschließen einer betrieblichen Berufsausbildung.
Die Studierenden:
- kennen Ausbildungsvoraussetzungen und können Ausbildung planen (Handlungsfeld 1)
- wissen, was bei der Vorbereitung der Ausbildung und der Einstellung von Auszubildenden zu beachten ist (Handlungsfeld 2)
- erlangen grundlegende Kompetenzen zur eigenständigen Planung und Durchführung von Ausbildungssituationen und zum Verhalten in der Rolle des Ausbilders/ Ausbildenden (Handlungsfeld 3)
- kennen verschiedene Lernformen, Kriterien für deren Einsatz und sind in der Lage, Lernsituationen zu konzipieren und wissen, welche Aufgaben beim Abschluss der Ausbildung zu beachten sind (Handlungsfeld 4)
Mit Bezug auf die 4 Handlungsfelder werden insbesondere folgende Aspekte behandelt:
- Planung der Ausbildung: Organisation der Ausbildung, Ablauf, Beteiligte und deren Aufgaben in der Ausbildung, Voraussetzungen Ausbildungsbetrieb, Ausbilder, Einstellung, Ausbildungsvertrag, Einführung, Probezeit, rechtliche Rahmenbedingungen und Regelwerke
- Didaktische Prinzipien und förderliche Lernbedingungen, teilnehmerorientierte Ansätze, Auswahl und Einsatz von Methoden für Bildung und Ausbildung, Rollenverteilung und Umgang mit Auszubildenden und Mitarbeitern, Umgang mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten, Planen von Bildungsmaßnahmen und Konzeption einer Ausbildungseinheit/Unterweisung (Erstellung einer Arbeitszergliederung und Feinplanung)
- Kriterien und Vorgehensweisen zur Evaluierung bzw. Lern-/Erfolgskontrolle
- Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf ziehen
Die Veranstaltung beinhaltet den theoretischen Teil der Ausbildereignungsprüfung für den Beruf „Landwirt/-in“
Landwirtschaftliches Bauwesen (201-070)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Landwirtschaftliches Bauwesen
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Projekt, Vorlesung, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Ein reales Bauvorhaben, beispielsweise ein Rinder-, Pferde- oder Schweinestall, in Kooperation mit einem landwirtschaftlichen Betrieb wird konkretisiert
- Es findet eine Auftragsklärung mit dem Betrieb statt, der Standort wird vor Ort besichtigt und analysiert, unterschiedliche Planungsvarianten werden verglichen und umgesetzt
- Flankierend werden anhand der Vorlesungen die Grundlagen für Landwirtschaftliches Bauen vermittelt, dabei unterstützen Referenten aus der Praxis, z. B. Fa. AgriConcept, Fa. ObjektplanAgrar
- Die Studierenden lernen softwaregestützte Applikationen beispielsweise in den Bereichen Standortbeschreibung, Kostenkalkulation, Bestandsplanung, Abstandsplanung, 3-DVisualisierung o.ä. kennen und wenden diese selbst an
- Im Rahmen der Projektarbeit werden folgende Inhalte erarbeitet:
- Projektorganisation inkl. Auftragsklärung, Projektstrukturplan, Zeitplanung, Projektdokumentation
- Erfassen der Ausgangssituation (Maschinenausstattung, Arbeitskräfte, Ressourcen)
- Standortbeschreibung anhand Topografie, Klima, Emissionen
- Raum- und Funktionsplanung
- Entwicklung eines Haltungskonzeptes inkl. Planungsvarianten
- Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Bestimmung und Erläuterung eines Haltungssystems
- Erstellung eines Lageplans (M 1:500)
- Erstellung von Planungsunterlagen - Grundriss u. Schnitt (M 1:200)
- Bewertungen der Planung und verschiedener Alternativen nach: Kapitaleinsatz, Arbeitswirtschaftlichkeit/ Arbeitserledigung/ Arbeitsbelastung, Tierwohl, Umweltaspekten, Entwicklungsfähigkeit des Betriebes und Nachhaltigkeit der Baumaßnahme
Tiergesundheitsmanagement (201-074)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Mündliche Prüfung (15 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Tiergesundheitsmanagement
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Das Modul befasst sich vertiefend mit den drei großen Abgangsgründen bei Rind und Schwein: Fruchtbarkeit, Euter/Leistung und Klauen. Neben Theorieeinheiten steht vor allem die praktische Arbeit im Vordergrund. Im Rahmen des Moduls werden die folgenden Themenkomplexe behandelt:
Reproduktionsmanagement bei Rind & Schwein:
- Theorie: Physiologie & Pathologie der Fortpflanzung, Reproduktionsmanagement, physiologischer Ablauf der Geburt & geburtshilfliche Maßnahmen
- Praxis: Besamungsübungen an Organen, Geburtshilfeübungen (Lage-, Stellung- und Haltungsanomalien) am Modell
Klauengesundheit & Klauenpflege bei Rind & Schwein:
- Theorie: Klauenaufbau, Klauenerkrankungen, funktionelle Klauenpflege
- Praxis: an Schlachthofpräparaten werden die verschiedenen Schnitttechniken erlernt und funktionelle Klauenpflege durchgeführt
- eventuell zusätzlich Einbeziehung kleiner Wiederkäuer
Datenanalyse:
- Theorie: Aufbau der Daten, Rückschlüsse aus den Daten
- Übung: Datenanalyse zu verschiedenen Themenschwerpunkten (Fruchtbarkeit, Leistung, Eutergesundheit, Lungengesundheit)
Prophylaxemaßnahmen für den Bestand:
- Prophylaxemaßnahmen in Theorie und auf dem Praxisbetrieb (Immunprophylaxe- und Biosecurity-Maßnahmen für den Bestand)
Erneuerbare Energien - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte (201-075)
Verantwortlich: Prof. Dr. Carola Pekrun
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Erneuerbare Energien - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung, Seminar, Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Übersicht EE-Produktion und -Verbrauch sowie technische Herausforderungen der EE-Technik (Wind, PV, Biomasse, Wasserkraft, Sonstige)
- Politische Rahmenbedingungen und Akzeptanz und Nachhaltigkeitskommunikation
- Landschaftsplanerische Aspekte der EE-Produktion
- Anbau von Energiepflanzen (Biogas und Lignozellulose)
- Finanzierung von EE-Anlagen, Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement in Betrieben
- Konsumentenpräferenzen für EE-Vermarktung von EE-Strom- und Gasprodukten
- Risiken und Risikomanagement von EE-Anlagen
Smart Farming und Agrarsysteme der Zukunft (201-105)
Verantwortlich: Prof. Dr. Markus Frank
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Mündliche Prüfung (20 Minuten) und Studienarbeit (50/50)
Lehrveranstaltung 1: Smart Farming
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)
Inhalte
- Geschichte und biophysikalische Grundlagen; Sensortechnologien und Datenverarbeitung
- Farm Management InFormat:ionssysteme
- Teilflächen-spezifisches Management anhand von Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz und Bewässerung
- Autonome Maschinen und Robotik
- Nachhaltigkeitsanalyse und "Blockchain" als Vehikel für neuartige Geschäftsmodelle
- Wahrnehmungen und Akzeptanz bei relevanten Interessensgruppen
- Zukunftsszenarien und Technikfolgenabschätzung
Lehrveranstaltung 2: Agrarsysteme der Zukunft
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung, Seminar (Präsenz)
Inhalte
- Landnutzungsformen und ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung
- Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme heute und in der Zukunft (z.B. urbane Landwirtschaft, Agrarforst-Systeme, Permakulturen, regenerative Landwirtschaft; vertikale Landwirtschaft)
- Ökosystemdienstleistungen, insbesondere im Spannungsfeld Landnutzung uND Biodiversität
- Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Landnutzungstypen
- Bewertung der Nachhaltigkeit von Agrarsystemen der Zukunft
- Zielkonflikte aus Sicht relevanter Akteure und Lösungsstrategien
Wahlmodule Sommersemester
Handelsmarketing und Direktvermarktung (201-065)
Verantwortlich: Prof. Dr. André Bühler
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Handelsmarketing und Direktvermarktung
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit integrierten Übungen/Fallstudien (Präsenz)
Inhalte
- Definitionen, Begriffsabgrenzungen und Konzepte des Handelsmarketing
- Unterschiedliche Distributionswege
- Die Situation und Entwicklungen im deutschen Einzelhandel
- Die richtige Standortwahl
- Der Marketing Mix im Handel
- Multi-Channel-Marketing
- Konzepte und Instrumente der Direktvermarktung
- Digitalisierung und Digitales (Handels-)Marketing
Planung und Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe (201-066)
Verantwortlich: Prof. Dr. Ludger Hinners
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Mündliche Prüfung (15 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Planung und Optimierung landwirtschaftlicher Betriebe
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
Planungsmethoden:
- Voranschläge und Programmplanung
- Mathematische Programmierung
- Entscheidungs- und spieltheoretische Ansätze
Planungsgegenstände:
- Optimierung des Produktions- und Faktoreinsatzprogramms
- Optimierung der Produktions- und Faktoreinsatzintensität
- Integrierte Produktions-, Investitions- und Finanzplanung
- Entscheidungen bei Unsicherheit
Digitale Betriebsführung und EDV-gestütztes Rechnungswesen (201-095)
Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Schmid
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Digitale Betriebsführung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit PC-Übungen (Präsenz)
Inhalte
Grundlagen und Definition Digitaler Betriebsführung
Funktionsweise von Farm Management InFormat:ionssystemen
Digitale Werkzeuge in der landwirtschaftlichen Betriebsführung für Dokumentation, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Entscheidungsunterstützung, Steuerung und Kontrolle von Maschinen, Nutzung tierbezogener Daten, Beschaffung und Vertrieb, Datenaustausch mit Marktpartnern und Behörden
Betriebswirtschaftliche Bewertung digitaler Maßnahmen;
Risiken der Digitalisierung und Datensicherheit;
Gesellschaftliche Akzeptanz der Digitalisierung
Lehrveranstaltung 2: EDV-gestütztes Rechnungswesen
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Teilgebiete und Aufgaben des Rechnungswesens in Handelsbetrieben
- Finanzbuchführung und Abschluss unter besonderer Berücksichtigung des Warenverkehrs
- Leistungs-Kostenrechnung und Kalkulation von Handelswaren
- Betriebsvergleich im Handel
- Analyse des Jahresabschlusses, Ermittlung und Vergleich von Kennzahlen
- Erstellung von Ergebnistabellen und BAB
- Kalkulation von Verkaufspreisen, Sonderangeboten und Aktionsfonds
- Berechnung von Deckungsbeiträgen zur Sortimentssteuerung;
- Verbuchung des Warenverkehrs;
- Erstellung und Bearbeitung von Gewinnverteilungstabellen.
Management ausgewählter Tierarten (201-097)
Verantwortlich: Prof. Dr. Maren Bernau
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Klausur (90 Minuten)
Lehrveranstaltung 1: Spezielle Tierarten
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Bedeutung, Produktionsverfahren und ökonomische Kenndaten zu speziellen Tierarten (Geflügel, kleine Wiederkäuer, Strauße, Alpakas, Zootiere)
- moderne Zuchtarbeit bei den ausgewählten Tierarten
- Haltungs- und Gesundheitskonzepte der verschiedenen Tierarten
Lehrveranstaltung 2: Spezielle Tierernährung
Umfang: 2 SWS (2,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung (Präsenz)
Inhalte
- Ernährung spezieller Tierarten hinsichtlich ernährungsphysiologischer Aspekte, Futtermittelauswahl, Futterrationsgestaltung, Fütterungskosten und Fütterungstechnik
- Futterrationsberechnung und -optimierung anhand eines EDV-Futteroptimierungsprogramms inkl.- Betrachtung der Nährstoffausscheidungen und Umweltwirkung
- Beurteilung von Fütterung, Futtermitteln, Fütterungstechnik und Produktionsverfahren auf ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben
Bienen als Anwendungsobjekt für Social Entrepreneurship (201-100)
Verantwortlich: Prof. Dr. Barbara Benz
Umfang: 4 SWS (6 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen Bienenkunde + Praktische Imkerei
Umfang: 1 SWS (1,5 ECTS)
Format: Seminar, Projekt (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen zur Biologie, Lebensform und Kommunikation von Honig- und Wildbienen
- Leistungen der Bienen und Einfluss auf Biotope
- Bienengesundheit
- Trachtpflanzen
- Einfluss des Klimawandels auf Bienen
- Bienenprodukte (Honig, Pollen, Wachs, Kosmetikprodukte)
- Imkerliche Tätigkeiten zur Pflege von Honigbienenvölkern und zur Gewinnung von Produkten aus der Bienenhaltung
Lehrveranstaltung 2: Grundlagen Geschäftsmodelle und Projektarbeiten
Umfang: 3 SWS (4,5 ECTS)
Format: Vorlesung mit Übung und Exkursion (Präsenz)
Inhalte
- Grundlagen zu Geschäftsmodellen wie Value Proposition Canvas, Business Model Canvas und Social Business Model Canvas
- Elemente der Entwicklung von Geschäftsmodellen und Unternehmen
- Entwicklung von Produkt- oder Dienstleistungsangeboten auf Basis der Bienenvölker
- Austausch mit wichtigen Stakeholdern, Lösungen entwickeln, diese auf ihre Umsetzbarkeit und Rentabilität prüfen und den Vorschlag überzeugend vor einem Kreis aus Entscheidern präsentieren
International Food and Agricultural Business (201-104)
Verantwortlich: Prof. Dr. Heinrich Schüle
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Prüfung: Studienarbeit
Lehrveranstaltung 1: International Food and Agricultural Business
Umfang: 4 SWS (5 ECTS)
Format: Seminar mit Exkursion (Präsenz) in englischer Sprache
Inhalte
Am Beispiel einer ausgewählten Region bzw. eines Landes erfolgt in Kleingruppen die Analyse der dortigen Agrar- und Ernährungswirtschaft anhand der nachfolgenden Kriterien:
- Historische, politische und gesellschaftliche Entwicklung
- Natürliche, ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen der Land- und Ernährungswirtschaft
- Struktur und Wirtschaftlichkeit von land- und pferdewirtschaftlichen Betrieben sowie von Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs
- Situation und Entwicklung der wichtigsten Märkte für Agrarprodukte und landwirtschaftliche Betriebsmittel
- Aktuelle agrar-, umwelt- und handelspolitische Entwicklungen
Während einer 10-tägigen internationalen Exkursion erhalten die Studierenden die Möglichkeit, die verarbeiteten SekundärinFormat:ionen in der Diskussion mit Betriebsleitern und Vertretern von Institutionen des Agrarbereichs zu überprüfen und zu ergänzen.

Berufsfelder
Der Bachelorstudiengang qualifiziert für zahlreiche Berufe:
- in der praktischen Landwirtschaft als selbstständige*r oder angestellte*r Betriebsleiter*in
- in der Betriebsberatung
- in der Verwaltung von Bund, Ländern und Kreisen bei Agrar- und Umweltbehörden
- bei Verbänden und Organisationen, z.B. im Tierzucht- und Pflanzenbaubereich
- in der vor- und nachgelagerten Industrie, z.B. Agrartechnik, Saatzucht, Futtermittel
- im Ernährungsgewerbe und Bioenergiebereich
- im Handels- und Dienstleistungssektor (Banken, Versicherungen etc.)
- in der Umwelt- und Regionalberatung
- in Versuchs- und Forschungsanstalten
- in internationalen Organisationen und der Entwicklungshilfe
- im Tier- und Umweltschutz
- im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit
- Fachpresse und Medien
- für weiterführende Studiengänge im agrarwissenschaftlichen Bereich, z.B. Master of Science
Bewerbung und Zulassung
Mehr Informationen hierzu unter Bewerbung
Vorpraktikum
Für den Studiengang ist eine Vorpraxis (Praktikum) im Umfang von mindestens 12 Wochen im landwirtschaftlichen Bereich erforderlich. Praktika unter 4 Wochen können nicht als Vorpraxis anerkannt werden.
Mindestens 8 Wochen Praxis müssen bis zum Vorlesungsbeginn des ersten Semesters abgeleistet sein (Achtung: Prüfungsvoraussetzung). Der Nachweis muss bis spätestens 31. Oktober (1. Semester) beim Praktikantenamt eingereicht werden. Die Vorpraxis muss spätestens mit Beginn des Vertiefungsstudiums abgeschlossen sein. Der Nachweis muss bis spätestens 28. Februar (3. Semester) beim Praktikantenamt eingereicht werden.
Das Praktikum kann auf landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben (vorzugsweise anerkannten Ausbildungsbetrieben) abgeleistet werden. Die Praktikumsstelle soll nach Geschäftsumfang, Personalausstattung und Organisationsstruktur in der Lage sein, eine qualifizierte Ausbildung zu gewährleisten; möglichst mit einer zur Ausbildung befähigten Person. Ein absolviertes Praktikum ist durch eine Bescheinigung nachzuweisen. Diese muss Angaben zum Betrieb, den Zeitraum des Praktikums und die Tätigkeitsbereiche für den/die Praktikant*in enthalten. Anstelle eines Praktikums kann als Vorpraxis eine abgeschlossene Ausbildung in den folgenden Berufen anerkannt werden: Landwirt*in, Tierwirt*in, Pferdewirt*in, Fachkraft für Agrarservice, Winzer*in, Gärtner*in, Forstwirt*in, Landmaschinenmechaniker*in, Kaufmann/ Kaufrau im Agrarhandel, Landwirtschaftlich-technische Assistent*in (LTA), Staatlich geprüfte technische Assistent*in für Agrar- und Umweltanalytik; sowie ein mit Prüfung abgeschlossenes einjähriges landwirtschaftliches Praktikum (Praktikantenprüfung) oder die mehrjährige, regelmäßige Tätigkeit im elterlichen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb.
Eine Berufsausbildung ist durch Urkunde oder Zeugnis nachzuweisen (bis spätestens 31. Oktober (1. Semester) beim Praktikantenamt).
Leitfaden Praxissemester AW - Stand 11.01.2018

Erstsemester
Hier finden Sie verschiedene Informationen und Einführungsveranstaltungen zum Einstieg in Ihr Studium.


Alumni
Auch nach dem Studium wollen wir mit unseren ehemaligen Studierenden, den Alumni, in Kontakt bleiben.
Alumni Informationen, Netzwerke und Stellenbörse

Studium Agrarwirtschaft PLUS
Der Bachelor Studiengang Agrarwirtschaft PLUS (B.Sc.) an der HfWU wurde im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen der HfWU Nürtingen und dem MLR Stuttgart gemeinsam konzipiert. Agrarwirtschaft PLUS heißt, dass das Bachelorstudium Agrarwirtschaft an der HfWU und die landwirtschaftliche Lehre gleichzeitig absolviert werden.
Studium Agrarwirtschaft PLUS heißt …
- das Bachelorstudium Agrarwirtschaft und die Ausbildung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Landwirt:in miteinander kombiniert werden
- die Ausbildungszeit für Berufsausbildung und Studium verkürzt sich um ein Jahr auf insgesamt 4,5 Jahre
- praxisbezogene Kenntnisse zu erlangen durch die enge Verknüpfung der Arbeit im Ausbildungsbetrieb und dem Studium an der Hochschule
- die Praxisphasen der Ausbildung sind an das Studium angepasst
Karriere
Die exzellenten Berufsperspektiven liegen u.a. in folgenden Gebieten:
- In der praktischen Landwirtschaft als angestellter oder selbständiger Betriebsleiter
- In Unternehmen des Agribusiness
- In der Verwaltung von Bund, Ländern, Kreisen
- In Verbänden und Organisationen z. B. im Tierzucht- und Pflanzenbaubereich
- In der Agrartechnik
- In Versuchs- und Forschungsanstalten
- In Buchführung und Steuerwesen
- u.v.m.
Weiterhin qualifiziert das Bachelorstudium AgrarwirtschaftPLUS für diverse Masterstudiengänge.
Ablauf der Bewerbungen
- Bewerbung um einen Ausbildungsplatz im Beruf Landwirt:in inkl. Anmeldung bei den zuständigen Stellen für die Berufsausbildung Landwirt:in im jeweiligen Bundesland
- Beginn der Ausbildung spätestens zum 1. August und Durchführung einer 14-monatigen Ausbildungszeit im staatlich anerkannten Ausbildungsbetrieb im Beruf Landwirt:in
- Bewerbung um einen Studienplatz Agrarwirtschaft an der HfWU im darauffolgenden Jahr bis zum 15. Juli
• Infos zur Bewerbung unter: hfwu.de/bewerbung und hfwu.de/studierendensekretariat

Lehreinrichtungen
Lehr- und Vesuchsbetrieb Tachenhausen
To view this content (source: www.xyz.de), please click Accept. We would like to point out that by accepting this iframe, data could be transmitted to third parties or cookies could be saved. For more information, see our privacy policy.
Zur Unterstützung der praktischen Lehre in den Studiengängen Agrarwirtschaft (B.Sc.), Pferdewirtschaft (B.Sc.) und Nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft (M.Sc.) steht auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb Jungborn eine Anatomiesammlung zur Verfügung.
Die Anschauungsobjekte umfassen das Pferd, Rind, Schwein und Geflügel und zeigen tierartspezifische Besonderheiten und Unterschiede auf. Ergänzend zu den Exponaten sind auch Lehrvideos zu physiologischen Abläufen sowie pathologischen Veränderungen der Geschlechtsorgane, des Verdauungstraktes, des Hufes, der Beine, der Zähne und der Atemwege zu entdecken.
Die Anatomiesammlung auf dem Lehr- und Versuchsbetrieb Jungborn ist zur Zeit der Vorlesungen und Übungen vor Ort geöffnet. Außerdem ab dem Wintersemester 2022/2023 jeden 2. Montag von 14 – 16 Uhr oder auf Anfrage.
Ansprechpersonen: Stefanie Ferle
stefanie.ferle@no spamhfwu.de
Prof. Dr. Maren Bernau
maren.bernau@no spamhfwu.de
Aktuelles: 5 € für 25 m² Blühstreifen
Überall heißt es: es braucht mehr Blümchen für die Bienchen, Käfer und Co!
Wir sind bislang 42 Landwirt*innen, die gemeinschaftlich ein richtig gutes Projekt auf die Wege gebracht haben!
Wir werden in diesem Jahr unsere Ackerflächen nicht nur für die Lebensmittel- und Viehfutterproduktion nutzen, sondern freiwillig einen Teil der Natur zur Verfügung stellen.
Wir werden unsere Äcker mit bunten Blühmischungen miteinander vernetzen und dort auf einer Fläche von insgesamt mehr als 7 Fußballfeldern Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Vögel und viele mehr schaffen! Dabei ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Blühstreifen - also Lebensräume - miteinander verbunden sind. So können größere Distanzen von den vielen Insekten besser überwunden werden. Deshalb haben sich 8 Ortschaften in diesem Projekt zusammen geschlossen.
Wir hoffen, dass das Projekt gelingt und es auch im nächsten Jahr wieder blüht. So können jedes Jahr Blühstreifen entstehen, die wichtige Nahrungsquellen bieten und ein Wegenetz durch die Landschaft bilden.
Mehr Informationen unter: www.bluehende-alb.de
Das Bieneninformationszentrum
Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen legt im Studiengang Agrarwirtschaft besonderen Wert auf eine vielfältige und praxisbezogene Ausbildung. Diese ist nur in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit landwirtschaftlichen Betrieben und Verbänden möglich.
Im Rahmen eines Projektes haben Studierende des 6. Semesters der Agrarwirtschaft in Kooperation mit dem Bezirksimkerverein Nürtingen auf dem hochschuleigenen Lehr-und Versuchsbetrieb Tachenhausen ein Bieneninformationszentrum mit Lehrpfad zu Bienenweidepflanzen, Bienengesundheit und Bienenhaltung erstellt. Das Informationszentrum dient als Plattform für den Austausch rund um die Honigbiene und wird auch in Zukunft in Forschung und Lehre fest verankert sein.
Am 1. Juli 2016 wurde das Bieneninformationszentrum mit Bienenlehrpfad und Imkermuseum eröffnet. Informationstafeln mit Wissenswertem zu Bienenkrankheiten, Bestäubungsleistung, Imkeraufgaben etc., das Museum und Bienenweidepflanzen können nun besichtigt werden. Teil des Zentrums ist das alte Bienenhaus, in dem die Besucher*innen erfahren, wie sich die Imkerei im Laufe der Zeit entwickelt hat. Zudem kann die moderne Bienenhaltung in der Praxis erlebt werden, da Imker André Riehle mehrere Bienenvölker hier positioniert hat. Exponate wie eine Honigschleuder, Imkerpfeifen oder diverse Bienenbehausungen im Wandel der Zeit dienen der Veranschaulichung. Beispielhaft wurde ein bienenfreundlicher Vorgarten und verschiedene Blumenkästen mit Bienenweidepflanzen für den Balkon oder das Fenster gepflanzt.
Das Zentrum dient als Kommunikationsplattform für diverse Zielgruppen wie für Imker*innen, Landwirt*innen, Schulklassen, Haus- und Kleingärtner*innen bis hin zu Obstbauverbänden, Kommunen und Naturschutzverbänden. Nicht zuletzt dient die Anlage Studierenden als Forschungsfeld zu Fragestellungen der praktischen Bienenhaltung und des Pflanzenbaus.
Führungen:
Führungen können kostenpflichtig von Ende April bis Mitte August angeboten werden.
Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Bei einer höheren Teilnehmerzahl teilen wir die Gruppe entsprechend auf.
Es ist möglich, mehrere Gruppen parallel zu starten.
Preise:
Kindergruppe (bis 12 Jahre) 75,- € pro Gruppe
Erwachsenengruppe 95,- € pro Gruppe
Anmeldung:
Anmeldungen bitte über:
Dipl.-Kffr. Maike Schröter
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Neckarsteige 6-10 - 72622 Nürtingen
Tel.: 07022 - 201360
E-Mail: maike.schroeter@hfwu.de
Bitte planen Sie eine Vorlaufzeit von 4 Wochen ein.
Veranstaltungen
News Agrarwirtschaft

Ansprechpartner



Kontakt Vorlesungs- und Raumplanung
Auslandsbeauftragte

Professorinnen und Professoren AW, PW & NAE





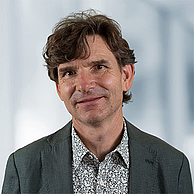








Kontakt Prüfungsausschuss: pa-favm@no spamhfwu.de
Leitung Prüfungsausschuss FAVM

Mitarbeiter Prüfungsausschuss FAVM



Bitte senden Sie alle Anfragen bezüglich des Vorpraktikums oder Praktikums an die unten stehende Praktikantenamt Adresse:
Kontakt Praktikantenamt: praktikantenamt-favm@no spamhfwu.de